Kirchlicher „Tag des Judentums“: Aufruf zu Dialog und Achtsamkeit
Gottesdienst des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) in der Wiener Ruprechtskirche Wien
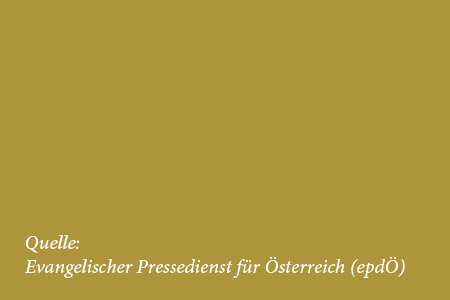
Gottesdienst des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) in der Wiener Ruprechtskirche
Wien (epdÖ) – Mit einem Gottesdienst in der Ruprechtskirche in der Wiener Innenstadt hat der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) am 17. Jänner den „Tag des Judentums“ begangen. Kirchenrektor Alois Riedlsperger begrüßte u.a. den ÖRKÖ-Vorsitzenden Bischof Tiran Petrosyan, den lutherischen Superintendenten Matthias Geist, den methodistischen Superintendenten Stefan Schröckenfuchs, den reformierten Landessuperintendenten Thomas Hennefeld, die altkatholische Bischöfin Maria Kubin, den syrisch-orthodoxen Chorepiskopos Emanuel Aydin, Kanonikus Patrick Curran von der Anglikanischen Kirche, P. Alexander Lapin von der Griechisch-orthodoxen Kirche sowie den Präsidenten des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Martin Jäggle. Beim Gottesdienst unter dem aus den Psalmen entnommenen Motto „Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle; ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit“ wurde gemeinsam für den Frieden in der Welt und besonders auch im Heiligen Land gebetet.
Bischöfin Kubin: „Weg zum Frieden gelingt nie durch einseitige Schuldzuweisungen“
Bischöfin Kubin ging in ihrer Predigt u.a. auf die biblischen Seligpreisungen ein, wo es heißt: „Selig, die Frieden stiften, sie werden Söhne und Töchter Gottes heißen.“ Frieden zu stiften sei ein unglaublich mühsames Unterfangen, bedeute es doch, Menschen, Gruppierungen, oft sogar Religionen oder ganze Völker, die miteinander verfeindet sind, zu einem Miteinander zu bewegen. „Der Weg zum Frieden gelingt nämlich nie durch einseitige Schuldzuweisungen, denn die Grenze zwischen Richtig und Falsch, zwischen Gut und Böse liegt nicht zwischen Einzelpersonen, Gruppen oder Nationalitäten, sondern immer in diesen selbst, sie geht immer mitten durch das eigene Herz“, unterstrich Kubin. Daher gehe es auch nicht darum, „herauszufinden, wer mit der Gewalt begonnen hat, sondern die entscheidende Frage wird sein, wer damit aufhören kann“. Das verlange menschliche Größe und sei freilich nicht unmöglich. „Wir haben es geschafft, Gräben zu überbrücken, die viel zu tief dafür zu sein schienen. Wir haben Kriege geführt, aber auch Frieden geschaffen. Wir haben Probleme verursacht, aber auch immer wieder Lösungen gefunden. Wir haben Gewalt verbreitet, aber wir sind auch Wege gegangen, um aus Unversöhntem wieder auszusteigen“, bekräftigte Kubin. Der Weg zum Leben, zur Freude und zum Glück führe über das Gemeinsame. Er gehe über die Erinnerung an den „langen gemeinsamen Weg und über die gemeinsame Tradition der heiligen Schriften, den wir mit Jüdinnen und Juden haben“.
Geist: Gedenken mit Entsetzen, Scham, aber auch Hoffnung
Der Wiener Superintendent Matthias Geist wies auf die Bedeutung des Tages hin, an dem sich die Christen in besonderer Weise ihrer Wurzeln im Judentum und ihrer Weggemeinschaft mit dem Judentum bewusst werden sollen und zugleich des Unrechts an jüdischen Menschen und ihrem Glauben in der Geschichte gedenken. „Ein Gedenken wie dieses, das wir heute mit Entsetzen, Scham, aber auch Hoffnung begehen, soll uns Mut machen: Mut zum Dialog, Mut zum Erinnern, Mut, achtsam zu sein“, erklärte Geist.
„Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen“, zitierte der Superintendent den evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der von den Nazis hingerichtet wurde. „Wir dürfen uns nicht christlich wähnen, ohne das Erbe in uns und an uns zu spüren und für dieses lautstark einzutreten“, fügte Geist hinzu.
Es gelte aufzuschreien, „wo Recht mit Füßen getreten wird, wo Menschen aufgrund ihres Glaubens, ihrer freien Meinungsäußerung, ihrer Hoffnungen, ihrer Herkunft, Sehnsüchte und Prägungen verunglimpft werden“. Geist kritisierte dabei den Angriff Russlands auf die Ukraine und den Terrorangriff der Hamas auf Israel. Es gelte aufzustehen gegen Hass, Neid, Feindseligkeit und Populismus und einzustehen und festzuhalten an dem, was Menschen aufrichte und zum Leben verhelfe.
Dantine: Verwurzelung im Judentum erkennen
„Wir können nicht um Einheit bitten, wenn wir nicht zuvor daran denken, wo wir herkommen, wenn wir also nicht unsere Verwurzelung im Judentum erkennen und bekennen“, sagte Olivier Dantine, Superintendent der Diözese Salzburg-Tirol, in seinem Grußwort zum Tag des Judentums am 16. Jänner im Haus der Begegnung in Innsbruck. Dantine warnte dabei vor einer Zunahme des Antisemitismus.
„Wir lesen von einer weltweiten Umfrage mit dem Ergebnis, dass fast die Hälfte der Menschen weltweit antisemitische Einstellungen vertritt. Eine alarmierende Zahl“, hob Dantine hervor, der gemeinsam mit dem katholischen Bischof Hermann Glettler, dem Christlich-jüdischen Lokalkomitee Tirol, dem Haus der Begegnung und der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Edith Stein zum Tag des Judentums lud. Als Gäste begrüßte er die Vertreter der Jüdischen Gemeinde sowie den Referenten Rabbiner Jehoschua Ahrens.
26. „Tag des Judentums“
Das Christentum ist von seinem Selbstverständnis her wesentlich mit dem Judentum verbunden. Damit dies den Christen immer deutlicher bewusst wird, hat der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) im Jahr 2000 den 17. Jänner als eigenen Gedenktag im Kirchenjahr eingeführt. Das Datum dafür wurde bewusst gewählt: So sollen die Kirchen den Geist dieses Tages in die anschließende weltweite „Gebetswoche für die Einheit der Christen“ vom 18. bis 25. Jänner weitertragen, denn bei allen Trennungen der Christenheit untereinander sei allen Kirchen gemeinsam, dass sie im Judentum verwurzelt sind, so die Veranstalter, darunter der „Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit“.
Infos: www.oekumene.at
