Neues Buch „Armut in der Krisengesellschaft“
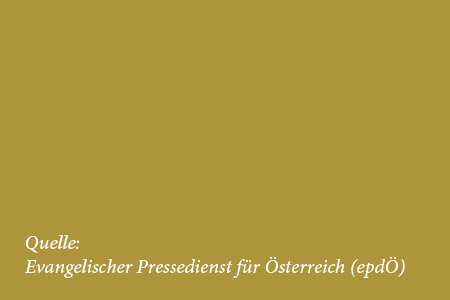
Schenk: Krisen machen Lücken sichtbar – Gesundheit und Bildung zur Armutsbekämpfung
Wien (epdÖ) – Gesundheitskrise, Teuerungskrise, Klimakrise. Welche Auswirkungen haben die Vielfachkrisen auf die Armut und die Menschen, die von Armut betroffen sind? Diese Frage leitet die Beiträge in dem neuen Buch „Armut in der Krisengesellschaft“. Darin legen die Sozialwissenschaftler Martin Schenk, Nikolaus Dimmel, Karin Heitzmann und Christine Stelzer-Orthofer eine erste komprimierte Analyse der letzten Krisenjahre von Pandemie bis Teuerung vor.
„Aus den zahlreichen empirischen Studien zu den Krisenjahren lernen wir zweierlei“, erläutert die Sozioökonomin Karin Heitzmann von der Wirtschaftsuniversität Wien. „Erstens: Krisen erhöhen tendenziell die Zahl der von Armut betroffenen Menschen. Dies gilt umso mehr in Zeiten von Polykrisen.“ Folgerichtig sei der europäische Indikator für Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung in Österreich zwischen 2018/19 und 2022/23 von 16,5% auf 17,7% gestiegen. „Zweitens treffen die negativen Auswirkungen dieser Krisen vor allem jene Bevölkerungsgruppen, die ohnehin häufig von Armut bedroht sind, und verschärfen deren prekäre Situation.“ Dies zeigt sich auch daran, dass sich die klassischen Armutsrisikogruppen kaum verändert haben.
Die höchsten Armutsgefährdungs- und Deprivationsrisiken weisen nach wie vor Arbeitslose, Niedrigeinkommensbezieher:innen, Alleinerziehende oder Großfamilien auf. „In Krisenzeiten werden daher auch die Versäumnisse und Fehlentwicklungen der Vergangenheit umso schmerzhafter sichtbar – auch für diejenigen, die nun neu von Armut und Ausgrenzung betroffen sind“, so Heitzmann.
„Im ersten Teil des Buches stehen die Krisen und Katastrophen – und ihre Auswirkungen auf Armut und Armutsbetroffene – im Mittelpunkt der Analysen“, erläutert Christine Stelzer-Orthofer von der Johannes Kepler Universität Linz. Im zweiten Teil werden die Armutsberichterstattung und Diskurse in den Blick genommen. Im dritten Teil steht schließlich die Armutsbekämpfung selbst zur Diskussion. „Die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes geben einen Überblick zur aktuellen Debatte. Sie analysieren, was im Kontext aktueller Krisen armutspolitisch besser oder anders gemacht werden kann, um das Ausmaß der Armut nachhaltig zu reduzieren“, so Stelzer-Orthofer.
Schenk: „Investitionen zahlen sich aus“
„Einen der höchsten Impacts in Armutsbekämpfung und -vermeidung haben Investitionen in Gesundheit und Bildung“, betont Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie und Mitbegründer der Armutskonferenz, und fügt hinzu: „Hier entstehen neben dem Effekt geringerer Armut auch weitere sozioökonomische Win-win-Situationen zwischen Einkommen, Arbeitsplätzen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und konjunkturellen Impulsen.“ Die gesamtwirtschaftlichen Kosten von Schulabbruch würden für Österreich etwa 1,1 Milliarden Euro im Jahr betragen. „Investitionen zahlen sich aus“, ist Schenk überzeugt.
Das kontinentale Sozialstaatsmodell habe zudem eine stark berufsständische Schlagseite: Dadurch werde die Entwicklung moderner Berufsbilder und integrierter Angebote behindert. Berufe zwischen Sozialarbeit und Gesundheitsversorgung seien in anderen Ländern leichter möglich, Grätzelarbeit werde selbstverständlicher mit Public Health verknüpft und Modelle wie „Social Prescribing“ versuchten, Gesundheit und Soziales zu integrieren. Weiter sei der Ausbau und die Weiterentwicklung von Primärversorgungszentren entscheidend. „In dieselbe Richtung gehen sogenannte Kinderhilfen, auch ‚Präventionsketten‘ genannt, die an den frühen Hilfen anschließen und sich an den Entwicklungsherausforderungen von Kindern orientieren“, sagt Schenk.
Zudem habe das kontinentaleuropäische Sozialstaatsmodell Probleme und Schwächen, wenn es um soziale Mobilität nach oben geht. Das österreichische Schulsystem weist einen besonders starken Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Herkunft und Bildungserfolg auf. Österreich zählt damit zu den OECD-/EU-Ländern mit den größten Leistungsdifferenzen nach sozialer Herkunft. Hier wären die Einführung eines Sozial- und Chancenindex für benachteiligte Schulstandorte, warme Mahlzeiten in der Schule, gute Kinderbetreuung und verfügbare Ganztagsschulen wirksame Interventionsmöglichkeiten, so Schenk.
