Glauben in der Arktis
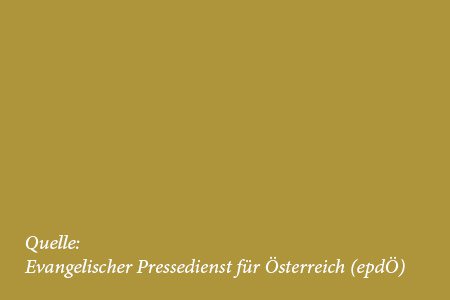
Gemeindealltag in der nördlichsten Diözese der Welt
Um von Aaron Solbergs Kirche zur nächsten Stadt zu kommen, muss man einen Charterflug nehmen. Zur nächstgelegenen Dorfgemeinde könnte man 12 Stunden lang mit einem Schneemobil über den gefrorenen Baker Lake in Kanada fahren. „Das ist gar nicht so einfach, da alles nur flach und weiß ist, da verliert man schnell die Orientierung“, erzählt der Pfarrer. Seit 2018 ist er anglikanischer Diakon in der Gemeinde St. Aidan Baker Lake in der kanadischen Provinz Nunavut.
Der Name bedeutet in Inuktitut, der Sprache der dortigen Inuit, so viel wie „unser Land“. Der gebürtige New Yorker mit deutschen Wurzeln ist gemeinsam mit seiner Frau Isabelle Solberg nach seinem Theologiestudium in Amerika in den Norden gezogen. „Ein Bekannter hat mir gesagt, ich soll mich doch in der Arktis bewerben, dort suchen sie Pfarrer“, erinnert sich Solberg. „Meine erste Aufgabe als Diakon hier war die Beerdigung von drei Menschen, die in den Wochen davor gestorben waren. Zwei davon waren Jugendliche, die Selbstmord begangen hatten.“
Infrastruktur ohne Straßen
„Wenn die Medien in Kanada über Nunavut berichten, erzählen sie immer nur, wie schrecklich hier alles ist, über Armut, die vielen Alkoholiker, die häusliche Gewalt und Selbstmorde. Und das gibt es hier auch alles“, erzählt Bischof Joey Royal, einer der vier Bischöfe der anglikanischen Diözese Nunavut. „Aber es gibt auch viele schöne Seiten an dem Leben hier oben im Norden.“ Nunavut ist flächenmäßig die größte Diözese der Welt. Sie umfasst viele kleine Dörfer, die oft nur ein paar hundert bis wenige tausend Einwohner haben. Die Weitläufigkeit wirkt sich auf das medizinische System aus: „In unserem Gesundheitszentrum gibt es ein Rad von Fachärzten, die jeweils für ein paar Wochen eingeflogen werden. Meine Frau ist gerade schwanger, ein Gynäkologe war aber nur einmal hier, er kommt erst wieder, wenn das Kind schon da sein wird“, so Diakon Solberg. „Einmal wurde ich zu einem Unfall gerufen, und die Krankenschwestern mussten den Kopf eines verunglückten Mannes drei Stunden lang in den Händen hochhalten und auf einen Rettungshubschrauber warten.“ Straßen gibt es kaum, besonders oberhalb der Baumgrenze sind die Dörfer aufgrund der fehlenden Straßen abgeschnitten.
Anglikanische, einem Iglu nachgeformte Kirche St. Jude in Iqaluit (Hauptstadt des kanadischen Territoriums Nunavut). Foto: Joey Royal
In der Hauptstadt Iqaluit, in der sich sowohl das Zentrum der Diözese als auch die theologische Ausbildungsstätte für Geistliche in der Arktis befinden, leben knapp 8.000 Menschen. Das hat Konsequenzen für die Arbeit von Bischof Royal: „Ich fliege zu fast allen Gemeinden bei meinen Besuchen, denn das Land ist gefährlich. Wenn man mit dem Schneemobil steckenbleibt, muss man schon ein Überlebenskünstler sein. Auch wenn man sich einen Iglu bauen und jagen kann, bis Hilfe kommt, so gibt es doch Bären und Wölfe.“ Und Pfarrer Solberg bringt es auf den Punkt: „Man muss sich das Leben der Menschen hier vorstellen wie in einem kleinen Dorf, in dem man eingesperrt ist. Durch die enormen Entfernungen ist man sehr isoliert. Das ist sicher auch ein Grund für die Depressionen hier“. Bischof Royal sieht als weiteren Grund dafür die vielen schmerzhaften Erfahrungen aus der Vergangenheit, „die durch die Geschichte des Kolonialismus verursacht wurden“.
„Die Kirche hat mir wehgetan, aber Jesus liebt mich“
Trotz der problematischen Kolonial- und Missionsgeschichte sind die Inuit in Kanada und auch in Grönland zum Großteil der christlichen Religion gegenüber sehr treu. „Der Süden von Kanada ist säkular, aber die Arktis ist es nicht. Die Menschen sind sehr religiös“, erklärt Bischof Royal. „Auch für die Menschen, die nicht regelmäßig in die Kirche gehen, spielt die Religion eine große Rolle“, so Aaron Solberg. „Es gibt hier im Dorf fast niemanden, der nicht von sich sagt, dass er an Gott glaubt.“
Die Ethnologin Verena Traeger hat sich viel mit der Geschichte der Inuit beschäftigt: „Der traditionelle schamanische Glaube der Inuit ließ sich gut mit der christlichen Botschaft der Missionare verbinden.“ Diese Religion habe andere neben sich zugelassen. „Bei den Inuit wurde die christliche Missionierung sogar zum größten Teil von Inuit selbst durchgeführt“, erklärt Bischof Joey Royal.
Kanadas Geschichte ist geprägt von einem dunklen Fleck, den so genannten Residential Schools (Internatschulen). Lange Zeit wurden die Kinder der Ureinwohner von ihren Familien isoliert und in weit entfernten christlichen Umerziehungsinternaten großgezogen. Viele Kinder wurden dort Opfer von Misshandlungen. In Kanada waren die letzten dieser Schulen noch bis 1996 geöffnet. „Die meisten hier, die schon etwas älter sind, waren noch selbst als Kinder in solchen Schulen“, erzählt Pfarrer Solberg. Und Bischof Royal ergänzt: „Was dort passiert ist, ist schrecklich. Schon in meiner Ausbildungszeit war ich bei den ‚Truth and Reconciliation Commissions‘, bei denen Überlebende des Residential School Systems über ihre Erlebnisse berichten. Erst vor einigen Wochen war ich wieder bei einer solchen Veranstaltung, um mir anzuhören, was den Menschen von den Kirchen angetan wurde. Was mir dort immer wieder begegnet: wie Menschen gelernt haben, zwischen der Kirche und ihrem Glauben zu unterscheiden. Sie sind in der Lage zu sagen, dass ihnen ihr Schmerz von der Kirche, aber nicht von Jesus zugefügt wurde. Der Glaube gibt ihnen Kraft, sie können sagen: Die Kirche hat mir wehgetan, aber Jesus liebt mich.“
Wissen
Die Arktis umfasst die nördlichen Gebiete von Alaska, Kanada, Grönland, Skandinavien und Russland. Die Ureinwohner von Nordalaska, Kanada und Grönland sind vorwiegend Inuit, übersetzt „Menschen“ (Inuk: „ein Mensch“). In Südalaska nennen sich die Ureinwohner Yupit und auf der Tschuktschen-Halbinsel in Sibirien Yuit. In Kanada werden die Inuit-Dialekte als „Inuktitut“ bezeichnet.
Die Inuit wurden ab 1721 mit der Missionsreise des dänisch-norwegischen Priesters Hans Egede missioniert. Ihm folgten 1733 die deutschen Herrnhuter auf Grönland, die ab 1771 ihre Mission auf die kanadische Region Labrador ausweiteten. Heute sind die Inuit zu über 90 % Angehörige einer christlichen Kirche. In den skandinavischen Ländern und in Grönland sind die Ureinwohner vorwiegend lutherisch, in Kanada großteils katholisch oder anglikanisch, in Labrador gehören die meisten Menschen zur Herrnhuter Brüdergemeine. In Alaska gibt es eine Vielzahl von Kirchen, darunter die Russisch-orthodoxe Kirche.
Liturgie in Inuktitut
„In unserer theologischen Ausbildung spielt die Sprache Inuktitut eine wichtige Rolle. Der Unterricht ist zwar auf Englisch, aber wir denken viel darüber nach, wie man gewisse Phänomene in Inuktitut übersetzen kann, nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell“, betont Amy Dow, Administratorin von ATTS, dem theologischen College der anglikanischen Diözesen der Arktis. „Auch Menschen, die aus dem Norden stammen, müssen viel lernen, um als Geistliche im Norden dienen zu können. Ich habe zum Beispiel einen Studenten hier, der überrascht ist, wie viel er über die Inuit-Kultur zu lernen hat, obwohl das seine eigene Kultur und Identität ist. Eine Identität zu leben und eine Kultur zu reflektieren sind zwei unterschiedliche Dinge.“ Die Natur spiele hier für die Menschen eine sehr wichtige Rolle.
„Die Liturgie, die Gebete und die Lieder in Inuktitut sind ein bedeutender Teil unserer religiösen und theologischen Identität“, unterstreicht Bischof Royal. „Ein spiritueller Zugang zum Leben ist normal. Darum können wir hier etwas in der Theologie praktizieren, was ich eine direkte Leseart der Bibel nenne. Wir brauchen den klassisch theologischen Weg über die historisch-kritische Methode nicht, um den Graben zwischen der antiken Welt und der Gegenwart zu überwinden. Hier weiß jeder, was mit ‚bösen Geistern‘ gemeint ist.“
Bischof Joey Royal (Mitte) mit Studentinnen und Studenten. Foto: anglican.ca
Vieles der gelebten Spiritualität erinnere auf den ersten Blick an Praktiken aus Pfingstkirchen. Trotzdem sind Pfingstkirchen derzeit die größte Konkurrenz der Anglikanischen Kirche in Nunavut. „Aber viele hier, die eine Zeit lang zur Pfingstkirche gehen, bleiben Teil unserer Kirche und kommen für die wichtigen Ereignisse im Leben wieder zu uns“, erzählt Aaron Solberg aus seinem Gemeindealltag. Diese Erfahrung teilt auch Ethnologin Verena Traeger: „Die Inuit sind gewohnt, zwei religiöse Zugänge miteinander zu verbinden, deshalb ist es gar kein so großer Widerspruch, sowohl die Pfingstkirchen als auch die anglikanischen Kirchen zu besuchen“. Die Religion der Inuit könne als Synkretismus gesehen werden, der animistische und christliche Elemente verbinde. Aber genau das erfordere theologisches Training.
Zukunft ohne Eis?
„Die Welt verändert sich, auch hier“, so Bischof Royal. „Die Jugendlichen haben Zugang zu Facebook, zum Teil werden sie säkularer als ihre Eltern. Der Klimawandel findet definitiv statt, niemand hier oben würde dagegen argumentieren. Die Wanderrouten der Tiere ändern sich, die traditionelle Jagd wird schwierig. Aber die Sicht darauf, was man dagegen tun soll, ist wahrscheinlich anders als bei euch im Westen. Auf Diesel zu verzichten und Recycling sind bei uns keine Optionen. Amazon hat hier mehr zur Ernährungssicherheit beigetragen als sonst jemand. Greenpeace-Aktivisten sind für viele hier ein rotes Tuch.“
2016 erschien der Dokumentarfilm „Angry Inuk“, der von einem „Kulturmord“ an den Inuit wegen der Kampagnen gegen die Robbenjagd berichtet. Robbenfleisch ist für traditionelle Inuit das Hauptnahrungsmittel. „Den Film hat einer meiner Nachbarn gemacht“, erzählt Bischof Royal. „Aber trotz aller Schwierigkeiten bin ich immer wieder erstaunt darüber, wie gut hier alles funktioniert. Das Leben ist in vieler Hinsicht einfach. Das Wichtigste für die Menschen sind die sozialen Beziehungen. Alles ist nahe beieinander, die Wege sind kurz, alles ist sehr direkt in dieser kleinen Struktur. Man lebt die Leichtigkeit des Seins hier.“ Pfarrer Solberg sieht einen tiefgreifenden Wandel auf die Gesellschaft der Inuit zukommen: „Manche der Jungen hier haben mit ihrer Identität zu kämpfen. Sie sind nicht mehr wie die Älteren, aber auch nicht wie die Weißen im Süden.“
Désirée Prammer
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Dieser Beitrag ist in der Juliausgabe der evangelischen Zeitung „SAAT“ erschienen. Die SAAT können Sie um 32 Euro pro Jahr auf epv-evang.at abonnieren.
