Maskenzeit
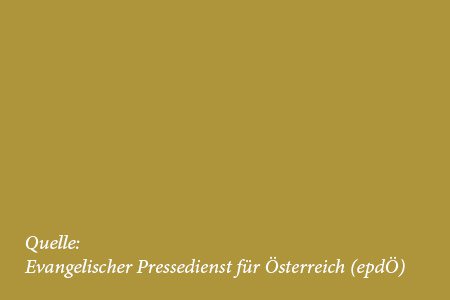
Julia Schnizlein über Verstellung und Wahrhaftigkeit
Ob Prinzessin, Narr, Engel oder Höllenfürst – an Fasching kann man endlich einmal sein, wer man sein will. Und viele genießen es, hinter Maske, Kostüm und mit verstellter Stimme in jede beliebige Rolle zu schlüpfen.
Aber während die Faschingskostüme am Aschermittwoch wieder in die Kästen wandern, bleiben unsere Alltagsmasken zurück. Die des „Grantlers“ zum Beispiel, der hinter der harten Schale den weichen Kern zu verbergen sucht. Oder die des „Pokerface“, der gelernt hat gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Und auch andere Masken bleiben uns wohl noch länger erhalten. Seit zwei Jahren haben wir uns daran gewöhnt, Teile unseres Gesichts hinter Masken zu verbergen. Manchen dient das Stück Stoff nicht nur zum Schutz vor Viren, sondern ist auch zum treuen Begleiter geworden, um das eigene Ich, Mimik, Gefühle und Gedanken in der Öffentlichkeit zu verbergen.
Im Digitalen sind Masken ohnehin an der Tagesordnung. Dort heißen sie: Filter. Sie machen uns jünger oder älter, dünner oder strahlender und verschleiern so unser wahres Gesicht.
Masken geben uns ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Mit einer Maske sind wir anonymer, angepasster und näher an der gesellschaftlichen Norm. Wir benutzen Masken, weil wir manches Mal einfach nicht die Kraft haben, wir selbst zu sein. Weil wir Angst haben, abgelehnt oder verletzt zu werden. Wir benutzen Masken, um unser Gesicht nicht zu verlieren – und verlieren es genau dadurch.
Es gibt einen, vor dem nützt uns keine Maske. Denn er kennt uns, er weiß, wer wir sind. Das hat schon König David verstanden als er vor rund 3.000 Jahren schrieb:
„Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ (Psalm 139)
Gott sieht uns, so wie er uns ursprünglich geschaffen hat. Nämlich nach seinem Ebenbild. Und er hat es für „sehr gut“ befunden. Es braucht keine Masken, um Gottes Kunstobjekt aufzupeppen. Wir sollten es lieber öfter wagen, zu Gottes Schöpfung und damit zu uns selbst zu stehen.
Folgen Sie Julia Schnizlein auch auf Instagram:
@juliandthechurch
