Assistierter Suizid: Bischof Chalupka vermisst Rechtsanspruch auf Palliativversorgung
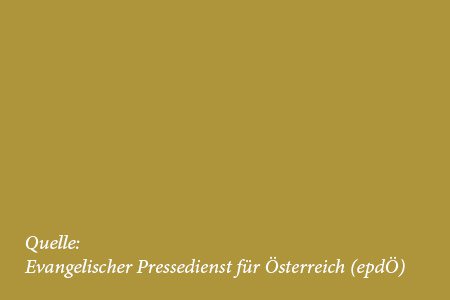
Schutz vor Missbrauch bekommt hohes Gewicht, Selbstbestimmung bleibt gewahrt
Wien (epdÖ) – Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka zeigt sich in einer ersten Reaktion erleichtert, dass nach fast einem Jahr endlich ein Gesetzesvorschlag zur Regelung des assistierten Suizids auf dem Tisch liegt, nachdem der Verfassungsgerichtshof im Dezember des Vorjahres das absolute Verbot der Suizidbeihilfe gekippt hatte, und kritisiert, dass „die Begutachtungsfrist für so eine wichtige Materie sehr kurz ist“. Mit der Regelung, die am 23. Oktober präsentiert wurde, bekomme der Schutz vor Missbrauch ein hohes Gewicht, zugleich werde der vom Verfassungsgerichtshof geforderten Selbstbestimmung Rechnung getragen, betont Chalupka gegenüber dem Evangelischen Pressedienst. Wichtig sei zudem die verpflichtende ärztliche und vor allem palliativmedizinische Beratung.
„Das Wichtigste für uns ist, dass es zu einem Vollausbau der Palliativ- und Hospizversorgung kommt. Ein flächendeckender Zugang muss unbedingt gegeben sein, wenn die Inanspruchnahme des assistierten Suizids möglich wird. Nur so kann verhindert werden, dass Menschen in den Suizid gedrängt werden“, so Bischof Chalupka. „Man muss aber fragen, ob die Finanzierung wirklich restlos geklärt ist und warum dieser Ausbau stufenweise bis 2024/25 erfolgt, wo er doch schon für 2020 versprochen war.“ Was fehle sei ein Rechtsanspruch für jeden und jede auf palliativmedizinische Versorgung.
Zur Frage der Anspruchsberechtigten meint Chalupka: „Unser Wunsch als Kirche war eine Beschränkung auf die terminale Phase, also auf unheilbare Erkrankungen, wenn das Lebensende absehbar ist. Das Gesetz spricht von unheilbarer, zum Tode führender Krankheit oder schwerer dauerhafter Krankheit, die Personen in ihrer Lebensführung dauerhaft einschränkt. Was man genau beobachten müssen wird, ist, was als schwere Krankheit angesehen wird.“
Superintendent Geist: Ethik-Beirat und verpflichtende Supervision fehlen
Der Wiener evangelische Superintendent Matthias Geist bewertete den Gesetzesentwurf zum assistierten Suizid positiv. Damit würde einem „Rechtsvakuum“ vorgebeugt, zumal ohne entsprechende Regelungen ab Jänner 2022 jede Form von Suizidbeihilfe erlaubt gewesen wäre. Via Facebook kritisiert Geist jedoch das Fehlen eines Ethik-Beirates in der Gesetzesvorlage. Ebenso fehle die verpflichtende Supervision für alle Beteiligten „inklusive Angehöriger und des medizinischen, pflegerischen, therapeutischen und pharmazeutischen Personals“. Auch den Verweis auf „Seelsorge und ihre qualitätsvolle, beraterische und spezifisch vertrauliche Dimension“ vermisst Geist.
Der frühere Gefängnisseelsorger Geist sieht zudem „totale Institutionen“ wie Gefängnisse oder psychiatrische Einrichtungen als Problemfelder. Hier würden sich bald „Unklarheiten“ bezüglich der Entscheidungsfähigkeit Betroffener bemerkbar machen. Ebenso werde die Beschränkung auf physische Erkrankungen Fragen aufwerfen, etwa bei „psychischer Belastung aufgrund lebenslänglicher Haft oder aussichtsloser Lage“.
Zum Hintergrund
Das neue „Sterbeverfügungsgesetz“ ist notwendig geworden, da der Verfassungsgerichtshof (VfGH) das Verbot des assistierten Suizids in Österreich mit Ende 2021 aufgehoben hat – nicht jedoch das Verbot der aktiven Sterbehilfe. Wäre bis zum Jahresende nichts geschehen, so wäre die Beihilfe zur Selbsttötung ab dem kommenden Jahr erlaubt gewesen, ohne dass es dazu weitere Regelungen gegeben hätte. Zahlreiche Institutionen vor allem aus dem medizinischen Bereich, aber auch die Kirchen, Religionsgemeinschaften oder NGOs wie die Diakonie haben daher auf eine rechtliche Absicherung gedrängt, damit es nicht zu Missbrauch kommt.
Eine „Sterbeverfügung“, mit der man sich zur Möglichkeit des assistierten Suizids entscheidet, kann nur „höchstpersönlich“ vom Betroffenen selbst errichtet werden, betonten Justizministerin Alma Zadic (Grüne), Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am 24. Oktober bei einem Hintergrundgespräch. Berechtigt dazu ist jede dauerhaft schwerkranke oder unheilbar kranke Person. Diese muss volljährig und entscheidungsfähig sein. Notwendig, um eine Sterbeverfügung (bei Notaren oder Patientenanwälten) zu errichten, ist die Aufklärung durch zwei Ärzte. Eine aufrechte Sterbeverfügung berechtigt sterbewillige Personen zum Bezug eines letalen Präparats in einer Apotheke. Das Präparat (das der Gesundheitsminister per Verordnung festlegt) muss selbstständig zugeführt werden. Sollte man nicht in der Lage sein, das Mittel oral einzunehmen, ist auch eine andere Gabe, etwa über eine Sonde möglich. Allerdings muss in diesem Fall der Betroffene selbst diese Sonde auslösen. Straffrei bleibt Sterbehilfe nur über den Weg des in den Apotheken künftig erhältlichen Medikaments und über den skizzierten Ablauf, betonten die Regierungsvertreter. Aber auch hier gibt es Einschränkungen: Bei Minderjährigen, aus verwerflichen Gründen (wenn man etwa aus Habgier hilft), bei Personen die nicht an einer schweren Krankheit leiden sowie wenn keine ärztliche Aufklärung erfolgt, ist auch dieser Weg verboten.
Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung
Begleitend kommt es zu einem Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung. Dazu soll ein eigener Fonds errichtet werden. Ab dem Jahr 2022 stellt der Bund den Ländern jährlich einen Zweckzuschuss zur Verfügung, vorgesehen ist eine Drittelfinanzierung durch Bund, Länder und Gemeinden. 2021 gibt es vom Bund 21 Millionen Euro, 2023 dann 36 Millionen und 2024 51 Millionen. Schöpfen Länder und Gemeinden die vollen Mittel aus, stünden damit etwa 2024 insgesamt 153 Millionen Euro zur Verfügung. Aktuell gibt es laut Regierungsinformationen seitens des Bundes sechs Millionen Euro pro Jahr, inklusive Land- und Gemeindemittel insgesamt 18 Millionen Euro.
